64, Teil I: Überraschung im Trockenwald
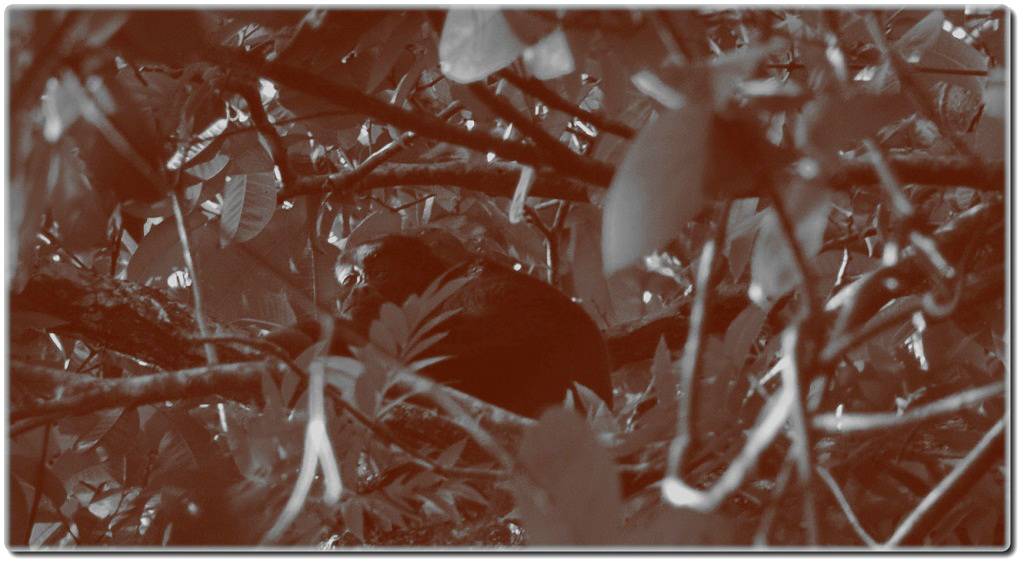
Costa Rica, August 2014.
<<Was ist es, das einen erfüllt und die Bomben vergessen läßt, den Müll?
Ist es das metallenblaue Aufflattern eines Schmetterlings oder das imposante Gelb eines Tukanschnabels,
das Chillirot des winzigen Frosches,
ist es die Reglosigkeit des neonen Basilisken oder das ungeheure zirpende Lärmen der Zikaden,
ist es die geschäftige Gleichgültigkeit nahrungssuchender Nasenbären oder die weiße Eleganz der Greifen,
ist es das dunkle Dampfen des regenfeuchten Waldes oder die zitronene Frauenschuhorchidee auf Vulkanschutt,
ist es das hundertfache Geschrei sich sammelnder Vögel bei Sonnenuntergang oder der donnernde Knall eines Blitzschlages,
ist es der Blick eines Brüllaffen aus weiter Ferne von den Baumkronen hinab auf den dämmrigen Boden?<<
Diese Zeilen verschickte ich von La Fortuna aus als Postkarte ohne meinen Namen zu nennen. Ich würde keine Antwort erhalten, so bedurfte es keines Absenders.
Über ein Viehgatter, das ich sorgfältig hinter mir schloß, verließ ich die Ferienanlage, querte kurz Weideland, dessen Erdreich von unzähligen Hufspuren aufgeworfen wurde, und erreichte nach wenigen Minuten die ersten Bäume des Trockenwaldes, der um diese Jahreszeit hübsch grünte und angenehm belaub war. Ich bin ein absolutes Naturmädchen, stamme vom Land und hege eine unstillbare Leidenschaft für Moor, Wald und Flur. Jeden Tag durchstreife ich die Gegend daheim, winters wie sommers, bei jedem Wetter, studiere die Pflanzen am Wegesrand, erfreue mich an Licht-Schatten-Spielen, an Farben und Düften und Begegnungen mit Tieren, seien es Spinnen oder Eichhörnchen oder Bussarde. Jetzt stand ich am Eingang eines mir fremden, exotischen Waldsystems, Tausende von Kilometern von der Heimat entfernt, sog tief den würzigen Geruch feuchter Erde und satten Grünes ein, ließ mich von dem Lufthauch streicheln und lauschte dem raschelnden Geräusch meiner Schritte und dem gelegentlichen Pfeifen der Vögel in den Wipfeln über mir. Ich genoß mein Schweigen, löste mich auf in der behaglich-kühlen Dunkelheit, die am Boden herrschte, staunte über Dornen bewährte Stämme, das merkwürdige Klacken auffliegender Schaben, das rieselnde Flattern der gigantischen blauglitzernden Schmetterlinge, die an mir vorüberschwebten wie aus einer anderen Welt. Es gelang mir, einen Kuckuck in leuchtend rostrotem Gefieder mit der Kamera zu bannen, obwohl er sich alle Mühe gab, sich duckend mit dem Astgewirr zu verschmelzen.
Da hörte ich das typisch schwere Brechen feiner Zweige, das Schwingen in den Kronen, das Reißen von Laub, und schaute angestrengt nach oben, wo ich die Affen wußte. Hellgrün breitete das Blattwerk sich aus, doch verschwamm alles im überstrahlenden Gegenlicht. Trotzdem brauchte ich nicht lange zu verharren, bis ich die ersten Tiere ausmachte. Ihre langen Schwänze rollten sich haltsuchend um Äste, während die schwarzen Brüllaffen nach Früchten griffen, um sich an ihnen zu laben. Ich erkannte ein Junges, das schon alt genug war, um selbständig durch die Bäume zu toben. Eifrig fotografierte ich, freudig erfüllt von dem unerwarteten Aufeinandertreffen: Primaten in freier Wildbahn, eine fressende Gruppe – ich war aufgeregt wie beglückt, fuhr das Objektiv aus soweit wie möglich, versuchte, die sich munter bewegenden Affen in schönen Kompositionen und scharf gestellt einzufangen (ich verzichte ja auf den Autofokus…). Ich verweilte an einer besonders düsteren Stelle, wo es nach Moder roch, nach verfaulendem Holz und Pilzen. – – Ein Ruck! Mein Herz setzte aus, ich hüpfte zurück, die Augen Schreck geweitet, denn urplötzlich hatte sich zu meinen Füßen ein lautstarkes Quieken erhoben, empört, aggressiv, als würde ein Schwein abgestochen. Ich starrte auf den Grund, nahm Dunkelheit und sich zersetzendes Laub wahr. Nach etlichen Momenten der Stille quiekte es erneut, und da endlich entdeckte ich es: ein Gürteltier gleich neben meinem Bergstiefel, es erinnerte an ein Urzeitmonsterchen, irgendwie nackt und rosa und graubräunlich mit seinem Panzer und dem kahlen Schwanz und der langen Schnauze. Es huschte davon wie der Wind – daß solch ein kleines, kurzbeiniges, urtümliches Wesen dermaßen rasen kann! Reflexartig schoß ich drei, vier Bilder, ehe das aufgescheuchte Tierlein vollends im Unterholz verschwand. Mein Puls hämmerte wie verrückt. Ich fing an, zu lachen. Erleichtert.
Ich kontrollierte eines der soeben geknipsten Fotos am Kameramonitor: Boden und Gestalt flossen ineinander, Farben und Formen waren von der Geschwindigkeit malerisch verzerrt, und doch handelte es sich ganz unbestreitbar um ein Gürteltier, das da auf den rechten Bildrand zusprintete.
Die Affen über mir hatten sich von dem Tumult nicht stören lassen. Ich ging dennoch weiter, achtsamer als zuvor, auf einen Weißwedelhirsch und Rebhühner und riesige schwarze Käfer stoßend – nicht übel, für einen ersten kurzen Abendspaziergang.

